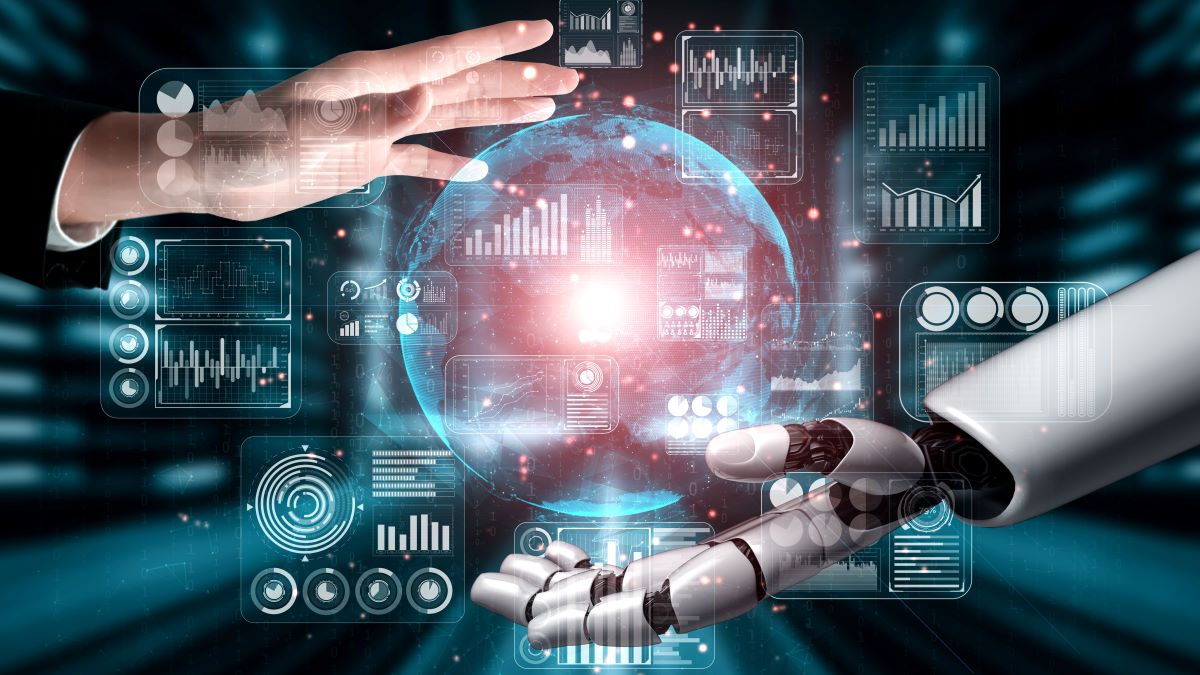Über 800.000 Schweizerinnen und Schweizer leben mittlerweile im Ausland – so viele wie noch nie zuvor. Der Trend zum Auswandern verstärkt sich dabei weiter: Allein im letzten Jahr haben sich 31.300 Menschen für diesen Schritt entschieden, während nur 21.900 zurückkehrten.
Die Entscheidung auszuwandern ist allerdings komplex und wirft viele Fragen auf. Während die Schweiz mit einem Medianlohn von 6.665 Franken und einer niedrigen Arbeitslosenquote lockt, sind die Lebenshaltungskosten hier auch 51% höher als beispielsweise in Deutschland. Tatsächlich verlieren Auswanderer je nach Zielland unterschiedlich stark an Kaufkraft – in Paris beispielsweise bis zu 28,2%.
In diesem ausführlichen Ratgeber erklären wir Ihnen ehrlich und transparent, was Sie beim Auswandern 2025 wirklich erwartet. Von finanziellen Aspekten über bürokratische Hürden bis hin zu emotionalen Herausforderungen – wir beleuchten alle wichtigen Facetten dieser lebensverändernden Entscheidung.
Warum Menschen 2025 auswandern: Die häufigsten Beweggründe
Die Entscheidung, sein Heimatland zu verlassen, fällt selten leicht. Dennoch planen laut einer aktuellen Umfrage knapp ein Drittel (30%) der Erwerbstätigen weltweit, in den nächsten fünf Jahren auszuwandern, um von besseren Arbeitsbedingungen zu profitieren. Was bewegt so viele Menschen dazu, diesen Schritt zu wagen? Die Motivation ist meist vielschichtig und hat sich 2025 deutlich gewandelt.
Berufliche Perspektiven im Ausland
Für viele Auswanderungswillige steht die berufliche Zukunft an erster Stelle. Menschen wandern aus, weil sie erwarten, ihr Leben und das ihrer Familien dadurch zu verbessern. Besonders deutlich wird dies am Beispiel Deutschland-Schweiz: Die Schweizer Löhne liegen bei gleicher Qualifikation um 30 bis 60% höher als in Deutschland. Diese Einkommensunterschiede locken jährlich tausende Deutsche in die Eidgenossenschaft – allein 2024 waren es 21.000.
Der Fachkräftemangel in vielen Zielländern spielt den Auswanderern dabei in die Hände. In der Schweiz fehlt beispielsweise durch den demografischen Wandel schon mittelfristig der Nachwuchs, um die Jobs zu besetzen, welche die Wirtschaft bietet. Ähnliches gilt für Kanada, das aufgrund seiner guten wirtschaftlichen Entwicklung sogar Jobbörsen in Deutschland veranstaltet.
Interessanterweise sind es oft nicht die Geringqualifizierten, sondern gerade gut ausgebildete Fachkräfte, die den Schritt ins Ausland wagen. Im Schnitt verfügen Auswandernde meist über ein höheres Bildungs- und Qualifikationsniveau als die einheimische Erwerbsbevölkerung im gleichen Alter. Dies führt in den Herkunftsländern mitunter zu einem problematischen “Brain Drain” – dem Verlust wichtiger Expertise.
Lebensqualität und Work-Life-Balance
Neben finanziellen Anreizen gewinnt die Work-Life-Balance zunehmend an Bedeutung. Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen durchschnittlich 90.000 Stunden bei der Arbeit verbringen – etwa ein Drittel unseres berufstätigen Lebens. Kein Wunder also, dass viele nach Ländern mit ausgewogeneren Arbeitsmodellen suchen.
Die nordischen Länder schneiden in diesem Bereich besonders gut ab. Dänemark sticht mit den weltweit kürzesten Arbeitszeiten hervor: Dort arbeiten Erwerbstätige im Durchschnitt nur sieben Stunden und 25 Minuten pro Tag. Auch die Länge der Arbeitspausen spielt eine Rolle. In der Schweiz, Portugal und Brasilien werden die längsten Pausen während des Arbeitstags eingelegt – zwischen 53 und 60 Minuten.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Pendelzeit. In den USA, Österreich und Finnland benötigen die meisten Arbeitnehmer durchschnittlich nur etwa 40 Minuten täglich für den Arbeitsweg – die kürzesten Zeiten weltweit. Im Gegensatz dazu haben Arbeitnehmer in Belgien mit 63 Minuten die längste durchschnittliche Fahrtzeit.
Besonders bemerkenswert: Obwohl Frankreich zu den fünf Ländern mit der besten Work-Life-Balance gehört, gaben fast 43% der französischen Arbeitnehmer an, dass sie in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine Beschäftigung in einem anderen Land suchen werden. Dies verdeutlicht, wie komplex die Motivlage ist.
Politische und wirtschaftliche Faktoren
Die politische und wirtschaftliche Stabilität der Zielländer spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. In vielen Herkunftsländern führt wirtschaftliche Unsicherheit zur Auswanderung, wie historische Beispiele zeigen: Die beginnende Industrialisierung ließ ganze Berufszweige aussterben und trieb Menschen zur Emigration.
Hinzu kommen steuerliche Überlegungen. Die Auswanderung wirkt sich auf die Staatsfinanzen aus: Die Einnahmen aus direkten Steuern können sinken, während der staatliche Ausgabenbedarf möglicherweise nicht in gleichem Maße zurückgeht. Für Auswanderer selbst können günstigere Steuersysteme im Zielland jedoch attraktiv sein.
Politische Stabilität und persönliche Sicherheit sind fundamentale Bedürfnisse, die viele zur Auswanderung bewegen. Kriminalitätsraten und politische Verhältnisse unterscheiden sich weltweit erheblich. In einigen europäischen Ländern wie der Schweiz sorgt das gute Verhältnis zwischen Bevölkerung und Regierung für zusätzliche Anziehungskraft.
Allerdings haben sich die Auswanderungsmuster verändert: “Heute zieht man eher um”, wie Experten betonen. Die Globalisierung und moderne Kommunikationsmittel ermöglichen es, den Schritt ins Ausland als weniger endgültig zu betrachten. Im Prinzip kann jede Entscheidung noch einmal rückgängig gemacht werden – ein beruhigender Gedanke für viele, die den Sprung wagen.
Es bleibt festzuhalten: Die Beweggründe für eine Auswanderung sind vielfältig und individuell verschieden. Was für den einen die Aussicht auf ein höheres Gehalt ist, kann für den anderen die Hoffnung auf mehr Freizeit oder politische Stabilität sein. Diese Faktoren gilt es sorgfältig abzuwägen, bevor man den bedeutsamen Schritt ins Ausland wagt.
Die emotionale Reise: Was Sie psychologisch erwartet
Auswandern ist weit mehr als nur ein Ortswechsel – es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die lange vor dem eigentlichen Umzug beginnt. Studien zeigen, dass vom ersten Gedanken an eine Auswanderung bis zur tatsächlichen Umsetzung durchschnittlich mindestens zehn Jahre vergehen. In dieser Zeit durchlaufen Auswanderer verschiedene psychologische Phasen, die maßgeblich über Erfolg oder Rückkehr entscheiden können.
Die Euphorie der Planungsphase
Die emotionale Reise beginnt meist mit großer Begeisterung und Vorfreude. In dieser Phase erscheint das neue Leben im Ausland – sei es in der Schweiz, Portugal oder Kanada – wie ein aufregendes Abenteuer. Diese anfängliche Euphorie wird in der Psychologie auch als “Honeymoon-Phase” bezeichnet.
Jedoch verbergen sich hinter der Vorfreude oft auch gemischte Gefühle. Viele Auswanderer berichten von Zweifeln und Ängsten, die besonders zunehmen, je näher der Abreisetermin rückt. Das Aufgeben des vertrauten Lebens – Job kündigen, Wohnung auflösen und Abschied von persönlichen Besitztümern, Freunden und Familie nehmen – führt immer wieder zu Verunsicherung.
Besonders wichtig: Studien zeigen, dass erfolgreiche Auswanderer sich bereits vor der Ausreise von Rückkehrern unterscheiden. Während Rückkehrer schon vor der Abreise davon ausgehen, im Zielland auf Probleme zu stoßen und starkes Heimweh zu bekommen, entwickeln erfolgreiche Auswanderer eine positive Grundeinstellung mit der Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen.
Kulturschock und Anpassungsschwierigkeiten
Nach der anfänglichen Euphorie folgt fast unvermeidlich der Kulturschock – eine psychologische und emotionale Reaktion auf das Leben in einer neuen, unbekannten Kultur. Dieser Prozess verläuft typischerweise in verschiedenen Phasen:
Zunächst erleben Auswanderer die Honeymoon-Phase, in der problematische Aspekte kaum wahrgenommen werden und Neugier und Faszination überwiegen. Darauf folgt die Frustrations-Phase (oder “Schock-Phase”), wenn sprachliche Barrieren, kulturelle Unterschiede und das Fehlen eines sozialen Netzwerks spürbar werden. In dieser Phase können Missverständnisse und Isolation zu Stress führen, und die neue Kultur wird möglicherweise als problematisch oder abweisend empfunden.
Schließlich erreichen die meisten Auswanderer die Anpassungsphase, in der sie zunehmend die Regeln und sozialen Strukturen verstehen und Strategien entwickeln, um mit den Unterschieden umzugehen. Dies geht allmählich in die Integrationsphase über, in der eine Balance zwischen der eigenen kulturellen Identität und der neuen Kultur entsteht.
Obwohl jeder Auswanderer diesen Prozess individuell erlebt, berichten viele von ähnlichen Symptomen während des Kulturschocks:
- Physische Reaktionen wie Kopfschmerzen, Verspannungen oder Schlafstörungen
- Emotionale Schwankungen wie Niedergeschlagenheit, Wut oder Verbitterung
- Sozialer Rückzug, Einsamkeit und Gefühle des Entwurzelt-Seins
Heimweh bewältigen
Heimweh – die schmerzliche Sehnsucht nach der Geborgenheit des Gewohnten – ist bei fast allen Auswanderern zeitweise präsent. Es kann durch verschiedene Auslöser verstärkt werden: wenn die anfängliche Euphorie nachlässt, bei besonderen Anlässen wie Feiertagen oder wenn plötzlich etwas Vertrautes auftaucht, das Erinnerungen weckt.
Für einen erfolgreichen Umgang mit Heimweh haben sich folgende Strategien bewährt:
Erstens, die Schaffung eines persönlichen Rückzugsortes im neuen Land. Dies kann durch das Mitbringen vertrauter Gegenstände gelingen, die emotionale Bindung vermitteln.
Zweitens, das Etablieren fester Routinen, die Struktur und Stabilität in den neuen Alltag bringen. Diese helfen besonders dann, wenn die Motivation nachlässt.
Drittens, der Aufbau sozialer Kontakte – sowohl zu Einheimischen als auch zu anderen Auswanderern. Gemeinsame Interessen können dabei als Anknüpfungspunkt dienen.
Dennoch gilt: Haben Sie Geduld mit sich selbst. Psychologen haben festgestellt, dass Menschen, die mitfühlend und verständnisvoll mit sich selbst umgehen, sich wesentlich besser einleben und seltener unter Heimweh leiden als jene, die sich unter Druck setzen.
Finanzielle Realität: Was Auswandern wirklich kostet
Hinter jeder Auswanderung steckt eine finanzielle Gleichung, die letztendlich aufgehen muss. Das Preisniveau und die Lebenshaltungskosten variieren weltweit erheblich und können den Traum vom Leben im Ausland entweder ermöglichen oder zunichtemachen. Während in der Schweiz beispielsweise ein identischer Warenkorb der Produktgruppe ‘Verkehr’ im Jahr 2023 etwa 126,2 CHF kostete, zahlte man in Deutschland 109,3 CHF, in Frankreich 109,6 CHF und in Italien nur 96,1 CHF.
Initiale Umzugskosten kalkulieren
Die ersten finanziellen Hürden beim Auswandern beginnen mit dem physischen Umzug selbst. Je nach Distanz, Transportmittel und Umzugsvolumen kann diese Erstinvestition erheblich schwanken. Für einen Umzug in ein deutsches Nachbarland mit komplettem Hausstand sollten Sie mit 2.000 bis 4.000 Euro rechnen. Bei Übersee-Umzügen, etwa in die USA, steigen die Speditionskosten auf rund 5.000 bis 10.000 Euro an.
Meine Erfahrung zeigt: Die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Umzugsunternehmen sind überraschend groß. Freunde haben für ihren Umzug von Norddeutschland in eine 3,5-Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich nur etwa 2.000 Euro bezahlt, während eine Berlinerin für ihren Umzug nach Basel rund 6.000 Euro ausgeben musste.
Außerdem fallen zusätzliche bürokratische Gebühren an, die oft übersehen werden. In der Stadt Zürich kostet beispielsweise allein die Anmeldung 40 Franken pro Person. Der Wechsel vom deutschen zum schweizerischen Führerschein schlägt mit weiteren 100 Franken zu Buche.
Besonders ins Gewicht fällt jedoch die Mietkaution. In vielen Ländern werden zwei bis drei Monatsmieten verlangt. Bei einer monatlichen Miete von 1.500 Franken für eine 3-Zimmer-Wohnung bedeutet das einen Kapitalbedarf von 3.000 bis 4.500 Franken.
Lebenshaltungskosten im internationalen Vergleich
Die Preisunterschiede zwischen Ländern können erheblich sein. Die Schweiz führt mit den höchsten Lebenshaltungskosten innerhalb Europas (ausgenommen Zwergstaaten). Als Faustregel gilt: Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind etwa 20-30% höher als in Deutschland, bei manchen Produkten sogar doppelt so hoch.
Dennoch profitieren Auswanderer in der Schweiz von deutlich höheren Löhnen. Während das durchschnittliche Brutto-Haushaltseinkommen in Deutschland bei etwa 4.900 EUR liegt, beträgt es in der Schweiz 9.951 CHF pro Monat. Dies gleicht die höheren Kosten mehr als aus.
Ein anschauliches Beispiel verdeutlicht diesen Unterschied: Herr Müller aus Italien nimmt eine neue Arbeitsstelle in der Schweiz an. Sein bisheriges Gehalt von 5.000 CHF muss dem Schweizer Preisniveau angepasst werden. Bei der Berechnung wird der Betrag durch das italienische Preisniveau (98,4) dividiert und mit dem Schweizer Preisniveau (183,7) multipliziert, was ein angepasstes Gehalt von 9.334,35 CHF ergibt.
In anderen beliebten Auswanderungsländern wie Spanien, Frankreich und Polen kann man hingegen oft günstiger leben als in Deutschland. Folglich lohnt sich vor der Entscheidung für ein Land ein genauer Blick auf das Verhältnis zwischen Einkommen und Ausgaben.
Notfallreserven und finanzielle Sicherheitsnetze
Der vielleicht wichtigste finanzielle Aspekt einer Auswanderung ist eine ausreichende Notfallreserve. Finanzexperten empfehlen, Reserven für mindestens sechs Monate, besser noch für ein Jahr anzulegen. Dies gibt Ihnen die nötige Zeit, um im neuen Land Fuß zu fassen oder bei Bedarf einen neuen Job zu finden.
Tatsächlich sind diese Rücklagen in manchen Ländern sogar Vorschrift für die Einreise oder die Aufenthaltsgenehmigung. Recherchen der Hans-Böckler-Stiftung zufolge haben jedoch nur ein Drittel aller Menschen ausreichende finanzielle Reserven – rund 70 Prozent leben von Zahltag zu Zahltag.
Neben dem monatlichen Auskommen sollten Sie auch Puffer für unerwartete Anschaffungen einplanen sowie Rücklagen für einen möglichen Rückzug nach Deutschland. Die Erfahrung zeigt: Selbst auf Mallorca gibt es Hilfsorganisationen, die obdachlose und gestrandete Deutsche zurück nach Deutschland bringen müssen.
Ein wesentlicher Faktor, der oft unterschätzt wird, ist die Absicherung im Krankheitsfall. Während in Deutschland die Krankenkassenbeiträge vom Arbeitgeber bezuschusst werden, zahlen Sie in der Schweiz die vollen Beiträge selbst – etwa 300-400 CHF monatlich. Das Fehlen einer passenden Krankenversicherung kann besonders für Rentner im Ausland problematisch sein.
Schließlich gilt: Auswandern ist kein Urlaub, sondern das echte Leben mit all seinen finanziellen Unwägbarkeiten. Die beste Absicherung ist daher eine realistische Finanzplanung, die sowohl die Kosten des täglichen Lebens als auch unvorhergesehene Ausgaben berücksichtigt.
Wohin auswandern mit wenig Geld: Bezahlbare Ziele
Der Traum vom Auswandern scheitert nicht selten an der Frage des Budgets. Allerdings gibt es weltweit zahlreiche Regionen, in denen ein angenehmes Leben auch mit begrenzten finanziellen Mitteln möglich ist. Wer bereit ist, sein Glück fernab der klassischen Auswanderungsziele zu suchen, wird überrascht sein, wie weit das eigene Geld reichen kann.
Südostasien als kostengünstige Alternative
Südostasien hat sich als Paradies für preisbewusste Auswanderer etabliert. In Thailand sind die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten um ein Vielfaches niedriger als in Europa. Mit rund 1.200 € monatlich lässt sich bereits ein sehr guter Lebensstandard führen, der Miete, Versicherungen und Grundgebühren einschließt. Zum Vergleich: Dieser Betrag deckt in Deutschland oft nur die monatliche Miete ab.
In Vietnam können Expats bereits mit 600-800 US-Dollar monatlich auskommen. Beeindruckend ist die Preisspanne bei Unterkünften: Ein 1-Zimmer-Apartment in Bangkok ist bereits ab 5.000 THB (ca. 130 €) monatlich erhältlich, luxuriösere Varianten beginnen bei etwa 15.000 THB (ca. 390 €).
Die Insel Bali hat sich inzwischen als internationaler Hotspot etabliert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgezeichnet, und mit 1.000 € monatlich genießt man dort zahlreiche Annehmlichkeiten, die in Europa unerreichbar wären. Zudem bieten die Philippinen mit ihren über 7.000 Inseln günstige Optionen – eine Mahlzeit in lokalen Gaststätten kostet oft weniger als 1 €.
Osteuropäische Länder mit niedrigen Lebenshaltungskosten
Im Gegensatz zum fernen Asien bietet Osteuropa für Deutsche den Vorteil der geographischen Nähe. Die Lebenshaltungskosten sind dort generell 20-40% niedriger als in Deutschland. Ein Restaurantbesuch kostet typischerweise nur 5-10 € für eine Hauptspeise, und eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr liegt zwischen 20 und 40 €.
Besonders Bulgarien sticht mit seinem pauschalen Steuersatz von nur 10% für Privatpersonen und Unternehmen hervor. Die Lebenshaltungskosten variieren je nach Stadt – Sofia ist als Hauptstadt am teuersten, während Städte wie Plovdiv und Varna erschwinglicher sind. Verglichen mit Paris ist das Leben in Sofia im Allgemeinen 50% günstiger.
Für 2025 werden neben Bulgarien auch Polen und Portugal als Top-Destinationen für preisbewusste Auswanderer genannt. Diese Länder kombinieren niedrige Lebenshaltungskosten mit einer hohen Lebensqualität, ohne dabei kulturelle Annehmlichkeiten zu opfern.
Lateinamerikanische Optionen für preisbewusstes Auswandern
Lateinamerika bietet ebenfalls zahlreiche kostengünstige Möglichkeiten. In Mexiko kann eine Person in kleineren Städten bereits mit 800-1.000 US-Dollar monatlich gut leben. Die argentinische Hauptstadt Buenos Aires ermöglicht mit etwa 700 € ein komfortables Leben inklusive einer Zweizimmer-Wohnung. In der mexikanischen Stadt Monterrey, die im Quality-of-Life-Index sogar vor New York City rangiert, reichen etwa 684 € monatlich für eine Ein-Zimmer-Wohnung plus Lebensunterhalt.
Darüber hinaus haben Länder wie Panama, Costa Rica oder Ecuador ein territoriales Steuersystem – das bedeutet, auf Einkünfte aus dem Ausland werden keine Steuern erhoben. Dies macht diese Länder besonders für ortsunabhängige Unternehmer und digitale Nomaden interessant.
Für Rentner bietet Costa Rica ein besonders attraktives Umfeld. Das Land hat 1948 seine Armee abgeschafft und die Mittel auf das Gesundheits- und Bildungswesen umgestellt. Die hohe Qualität der Gesundheitsversorgung ist ein Hauptgrund, warum viele Menschen hierher ziehen.
Falls Sie auf der Suche nach einem Ort sind, der Sie für Ihren Umzug sogar finanziell belohnt, lohnt ein Blick nach Spanien. In Dörfern wie Ponga erhalten Paare, die sich dauerhaft niederlassen wollen, einen Zuschuss von 3.000 Euro. Andere Gemeinden wie Olmeda de la Cuesta oder A Xesta bieten Grundstücke zu sehr niedrigen Preisen oder Wohnungen für nur 100 Euro Monatsmiete an.
Bürokratische Hürden meistern: Dokumente und Genehmigungen
Neben finanziellen Überlegungen stellen bürokratische Prozesse oft die größte Hürde beim Auswandern dar. Während EU-Bürger innerhalb Europas relativ einfach umziehen können, müssen Auswandernde in Drittstaaten zahlreiche administrative Herausforderungen meistern.
Visumsarten und Aufenthaltsgenehmigungen verstehen
Je nach Aufenthaltszweck und Zielland benötigen Sie unterschiedliche Aufenthaltsbewilligungen. Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und EU/EFTA-Staaten erleichtert zwar die Einreise und den Aufenthalt für Bürger dieser Länder, jedoch gelten für Personen aus anderen Ländern (Drittstaaten) restriktivere Bestimmungen.
Für die Schweiz gilt: Reichen Sie Ihr Gesuch für eine Aufenthaltsbewilligung bei Ihrer Wohnsitzgemeinde ein (außer im Kanton Genf, wo Sie sich direkt an den Kanton wenden müssen). Folgende Dokumente sind unverzichtbar:
- Aktuelle Bewilligung
- Identitätskarte oder gültiger Pass (bei Nicht-EU/EFTA-Bürgern mindestens drei Monate länger gültig als die beantragte Aufenthaltsbewilligung)
- Weitere länderspezifische Unterlagen
Besonders wichtig: Das Gesuch zur Verlängerung Ihrer Bewilligung können Sie frühestens drei Monate und müssen Sie spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Gültigkeit einreichen.
Während EU/EFTA-Bürger für einen 90-tägigen Aufenthalt in der Schweiz keine Anmeldung benötigen, müssen sich Personen aus Drittstaaten für alle Aufenthalte über 90 Tage zwingend innerhalb von 14 Tagen nach Ankunft bei ihrer Wohngemeinde anmelden.
Steuerliche Aspekte beim Auswandern
Beim Verlassen Ihres Heimatlandes enden Ihre steuerlichen Pflichten nicht automatisch. Zunächst müssen Sie frühzeitig vor der Abreise die Steuererklärung für das laufende Jahr einreichen, damit das Steueramt alle fälligen Steuern berechnen kann. Je nach Kanton müssen Sie vor dem Wegzug alle ausstehenden Steuern begleichen oder können diese vom neuen Wohnsitz aus bezahlen.
Allerdings bleiben Sie in der Heimat beschränkt steuerpflichtig, wenn Sie weiterhin Einkünfte daraus beziehen oder dort eine Immobilie besitzen. Um Doppelbesteuerung zu vermeiden, hat die Schweiz mit über 100 Staaten – darunter alle EU- und EFTA-Länder – bilaterale Abkommen abgeschlossen.
Interessanterweise müssen Sie in Ihrer Steuererklärung dennoch sämtliche weltweiten Einkünfte, Vermögen und Immobilien deklarieren. Obwohl beispielsweise ein Haus im neuen Wohnland nicht in der Schweiz besteuert wird, beeinflusst es den Steuersatz aufgrund der Progression.
Krankenversicherung und Sozialversicherung im Ausland
Mit dem Umzug ins Ausland ändert sich Ihr Versicherungsstatus grundlegend. Generell endet die obligatorische Krankenversicherung zum Zeitpunkt der Abreise aus dem Heimatland. Dennoch gibt es Ausnahmen: Manche Personengruppen wie Rentner, Grenzgänger oder entsandte Arbeitnehmende müssen beispielsweise in der Schweiz versichert bleiben.
Bei vorübergehendem Aufenthalt in EU/EFTA-Staaten oder dem Vereinigten Königreich können sich Versicherte mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK) behandeln lassen. Die Kostenbeteiligung richtet sich dabei nach den Vorschriften des jeweiligen Landes und muss in der Regel vor Ort bezahlt werden.
Darüber hinaus werden bei Notfällen außerhalb des EU/EFTA-Raums die Kosten bis zum doppelten Betrag übernommen, die bei einer Behandlung im Heimatland vergütet würden. Bei stationären Behandlungen übernimmt der Versicherer höchstens 90 Prozent der Kosten, die dieser Spitalaufenthalt zu Hause kosten würde.
Folglich sollten Sie vor dem Auswandern Ihre Versicherungssituation gründlich prüfen und entsprechend handeln, um Versicherungslücken zu vermeiden und die bestmögliche Absicherung im neuen Land zu gewährleisten.
Berufliche Neuorientierung im Ausland
Im beruflichen Kontext stellt das Auswandern besondere Herausforderungen dar. Während manche ihre Karriere nahtlos im Ausland fortsetzen können, müssen andere bei null anfangen. Der erfolgreiche Neustart hängt dabei von mehreren Faktoren ab – angefangen bei der Anerkennung von Qualifikationen bis hin zum Aufbau eines tragfähigen Netzwerks.
Anerkennung von Qualifikationen
Die Frage der Qualifikationsanerkennung ist entscheidend und unterscheidet sich je nach Berufsgruppe erheblich. Für reglementierte Berufe – insbesondere im Gesundheitswesen, im technischen oder juristischen Bereich sowie bei Sicherheits- und pädagogischen Berufen – ist eine formelle Anerkennung zwingend erforderlich. Hierfür benötigen Sie ein offizielles Dokument, das die Gleichwertigkeit Ihrer ausländischen Ausbildung bestätigt.
Zunächst sollten Sie prüfen, ob Ihr Beruf im Zielland überhaupt reglementiert ist. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) dient beispielsweise als nationale Kontaktstelle für Fragen zur Anerkennung von Berufsqualifikationen in der Schweiz. Die Bearbeitungszeit für ein Anerkennungsverfahren variiert je nach Beruf – bei reglementierten Berufen kann der Prozess bis zu vier Monate dauern.
Falls wesentliche Unterschiede zwischen Ihrer Ausbildung und den Anforderungen im Zielland bestehen, können Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sein. Dies kann von Eignungsprüfungen bis hin zu Anpassungslehrgängen reichen, die zwischen drei Monaten und drei Jahren dauern können. Für manche Berufe, besonders im Gesundheitsbereich, werden zusätzlich Sprachnachweise verlangt – typischerweise Niveau B2.
Remote-Arbeit als Einstiegsoption
Eine zunehmend beliebte Option ist das Remote-Arbeiten für Arbeitgeber im Heimatland. Besonders in der IT-Branche und bei Startups wächst die Bereitschaft, grenzüberschreitende Arbeitsbeziehungen zu akzeptieren. Allerdings eröffnen sich dadurch komplexe rechtliche Fragen in Bezug auf Arbeitsrecht, Datenschutz, Haftung und natürlich Steuer- und Sozialversicherungsrecht.
Bei Remote-Arbeit für Schweizer Unternehmen aus dem EU/EFTA-Raum gelten die EU-Verordnungen 883/2004 und 987/2009. Entscheidend ist das Erwerbsortprinzip: Arbeiten Sie mindestens 25% Ihres Pensums am Wohnort im Ausland, werden Sie dort sozialversicherungspflichtig. Gemäß den meisten Doppelbesteuerungsabkommen wird ein remote entrichtetes Schweizer Gehalt dort besteuert, wo die Arbeit physisch verrichtet wird.
Darüber hinaus bieten einige Länder wie Mexiko, Argentinien oder Panama besondere Vorteile für ortsunabhängige Arbeitende, etwa durch niedrigere Lebenshaltungskosten oder vorteilhafte Steuersysteme für Einkünfte aus dem Ausland.
Netzwerke aufbauen in der neuen Heimat
Ein starkes berufliches Netzwerk ist der Schlüssel zum Erfolg im Ausland. Folgende Strategien haben sich dabei bewährt:
- Berufsverbände und -vereine: Der Beitritt zu lokalen Fachorganisationen ermöglicht wertvolle Kontakte und Informationen über Entwicklungen in Ihrem Berufsfeld.
- Weiterbildung und Konferenzen: Seminare und Fachveranstaltungen bieten nicht nur Wissen, sondern auch Gelegenheiten zum Austausch mit anderen Fachleuten.
- Expat-Gruppen: In größeren Städten existieren zahlreiche Expat-Gruppen, die regelmäßige Treffen veranstalten und wertvolle Tipps zum Gastland geben können.
- Sportvereine und Hobbygruppen: Hier treffen Sie auf Einheimische mit ähnlichen Interessen – eine ideale Basis für neue Kontakte.
Besonders wichtig ist ein ausgewogenes Netzwerk aus anderen Ausländern und Einheimischen, um sich schneller einzuleben. Arbeitskollegen sind dabei oft die erste Anlaufstelle und können den Zugang zur lokalen Kultur erleichtern.
Schließlich sollten Sie moderne Plattformen wie LinkedIn für berufliche Kontakte und spezielle Expat-Websites nutzen. Eine offene Haltung, Geduld und die Bereitschaft, selbst in Vorleistung zu gehen, sind dabei entscheidende Erfolgsfaktoren für den beruflichen Neustart im Ausland.
Familie und soziale Bindungen
Die sozialen Bindungen sind oft die unsichtbaren Anker, die uns am stärksten zurückhalten, wenn wir über das Auswandern nachdenken. Besonders wenn Kinder involviert sind oder tiefe Freundschaften zurückgelassen werden müssen, gewinnt die emotionale Dimension an Bedeutung.
Mit Kindern auswandern: Besondere Herausforderungen
Für viele Eltern ist das Auswandern ein spannender neuer Lebensabschnitt, für Kinder hingegen häufig zunächst ein großes Problem. Ein Umzug bedeutet für sie primär Abschied – während Eltern ihren Lebenstraum verwirklichen möchten. Besonders kritisch ist die Situation bei Teenagern: Eine Langzeitstudie der University of Manchester zeigt, dass Umzüge die psychische Gesundheit vor allem bei 12- bis 14-Jährigen negativ beeinflussen können.
Familiensitzungen sind unverzichtbar. Es ist wichtig, Kinder von Anfang an in den Prozess einzubeziehen. Nehmen Sie ihre Einwände ernst und notieren Sie sich ihre Sorgen. Sätze wie “Papa hat eine großartige Karrierechance im Ausland und ihr müsst jetzt einfach auf die Zähne beißen” sind hingegen kontraproduktiv.
Unter zehn Jahre alte Kinder passen sich in der Regel leichter an, da ihre Hauptbezugspersonen die Eltern sind. Dennoch sollten Sie individuell auf die Bedürfnisse jedes Kindes eingehen, da introvertierte Kinder andere Unterstützung benötigen als extrovertierte.
Beziehungen zur Heimat pflegen
Nach einem Umzug ins Ausland verändern sich Beziehungen zwangsläufig. Viele “Freundschaften” kühlen trotz moderner Kommunikationsmittel ab. Tatsächlich bleiben oft nur wenige tiefe Verbindungen langfristig bestehen, besonders wenn die Initiative immer nur von einer Seite kommt.
Regelmäßige Besuche in beide Richtungen können helfen, wichtige Bindungen aufrechtzuerhalten. Für Kinder kann es wertvoll sein, ihnen zu ermöglichen, einmal jährlich jemanden aus der Heimat einzuladen oder halbjährliche Besuche in der Schweiz zu planen.
Moderne Technologien spielen eine entscheidende Rolle: Videoanrufe, Messaging-Apps und soziale Medien haben die Art, wie Auswanderer mit ihrer Heimat in Kontakt bleiben, grundlegend verändert. Diese digitalen Plattformen ermöglichen es, Beziehungen über große Entfernungen aufrechtzuerhalten und mindern Gefühle von Isolation und Heimweh.
Neue Freundschaften aufbauen
Der Aufbau eines neuen sozialen Netzwerks ist entscheidend für das Wohlbefinden im Ausland. Folgende Strategien haben sich bewährt:
- Aktivitäten aus der Heimat fortführen: “Am einfachsten ist es, wenn man Aktivitäten sucht, die man schon im Heimatland gerne gemacht hat”. Dies bietet natürliche Anknüpfungspunkte mit Gleichgesinnten.
- Lokale Angebote nutzen: Integrationsprogramme, Sprachkurse oder kulturelle Veranstaltungen erleichtern das Kennenlernen neuer Menschen. Besonders wirksam: Nach diesen Aktivitäten Zeit einplanen, um gemeinsam einen Kaffee zu trinken.
- Den Kontakt zu anderen Auswanderern suchen: Besonders am Anfang, wenn die Sprachbarriere noch groß ist, können Landsleute eine wichtige Stütze sein. Über Auslandschweizer-Organisationen, Facebook-Gruppen oder Botschaften lassen sich solche Kontakte finden.
Kinder können übrigens hervorragende “Türöffner” sein. Durch Schule und Freizeitaktivitäten ergeben sich oft auch für Eltern neue Bekanntschaften mit Einheimischen. Unterstützen Sie deshalb aktiv Ihre Kinder beim Finden neuer Freunde – sei es durch organisierte Spieltreffen für Kleinere oder Sportkurse und Jugendgruppen für Teenager.
Rückkehroptionen offenhalten: Der Plan B
Selbst mit bester Planung kann der Traum vom Auswandern manchmal anders verlaufen als erhofft. Ein gut durchdachter Plan B ist daher kein Eingeständnis des Scheiterns, sondern vielmehr ein Zeichen kluger Voraussicht. Experten empfehlen, stets ein Notfallbudget zurückzuhalten, das zumindest für die Rückflugtickets in die Heimat reicht.
Wann ist der richtige Zeitpunkt zurückzukehren?
Die Entscheidung zur Rückkehr ist hochindividuell und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Folgende Anzeichen können jedoch darauf hindeuten, dass ein Umdenken angebracht ist:
- Finanzielle Schwierigkeiten: Wenn die Ersparnisse zur Neige gehen und keine berufliche Perspektive in Sicht ist
- Anhaltende Integrationsprobleme: Wenn selbst nach längerer Zeit keine echte Verbindung zur neuen Heimat entsteht
- Familiäre Gründe: Etwa Pflegebedürftigkeit von Angehörigen oder Bildungsbedürfnisse der Kinder
“Ohne guten Plan zurückzukommen, kann man sich nicht leisten”, warnt eine Auslandschweizerin, die nach zwölf Jahren in Großbritannien wieder zurückgekehrt ist. Sie empfiehlt, Ersparnisse für rund ein Jahr einzuplanen.
Zudem ist der Zeitpunkt entscheidend: Bereiten Sie sich idealerweise mindestens sechs Monate im Voraus vor. Besonders wichtig dabei: Bleiben Sie während Ihrer Zeit im Ausland über politische und soziale Entwicklungen in der Heimat informiert. Dies erleichtert die spätere Reintegration erheblich.
Reintegration in die alte Heimat
Überraschenderweise kann die Wiedereingliederung genauso herausfordernd sein wie die ursprüngliche Auswanderung. Nach vier bis zwölf Wochen sind viele Rückkehrer wieder an das Alltagsleben gewöhnt, doch die berufliche und soziale Integration dauert länger.
Für einen reibungslosen Übergang sollten Sie:
- Frühzeitig Kontakt aufnehmen: Informieren Sie sich bereits vor der Rückkehr bei den zuständigen Behörden. In der Schweiz können Sie sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) anmelden.
- Finanzielle Unterstützung klären: EU/EFTA-Rückkehrer können unter bestimmten Voraussetzungen drei bis sechs Monate Arbeitslosengeld vom ehemaligen Wohnland beziehen – dafür muss jedoch vor der Rückreise ein spezielles Formular ausgefüllt werden.
- Qualifikationen hervorheben: Betonen Sie bei der Jobsuche konkret, welche Kompetenzen Sie im Ausland erworben haben. Die bloße Auslandserfahrung wird von Arbeitgebern oft neutral bis negativ bewertet.
Denken Sie daran: Eine Rückkehr bedeutet nicht zwangsläufig ein Scheitern. Vielmehr bringen Sie wertvolle interkulturelle Erfahrungen mit, die in einer zunehmend globalisierten Welt von unschätzbarem Wert sein können.
Fazit
Auswandern bedeutet zweifellos eine der größten Veränderungen im Leben. Dennoch zeigen die Erfahrungen tausender Schweizer Auswanderer: Mit gründlicher Vorbereitung und realistischen Erwartungen kann dieser Schritt erfolgreich gelingen.
Besonders wichtig erscheint dabei die Balance zwischen Träumen und Realität. Während finanzielle Aspekte und bürokratische Anforderungen oft im Vordergrund stehen, entscheiden letztlich die emotionale Anpassungsfähigkeit und ein stabiles soziales Netzwerk über den langfristigen Erfolg im Ausland.
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 800.000 Schweizerinnen und Schweizer leben bereits erfolgreich im Ausland. Gleichzeitig kehren jährlich etwa 21.900 Menschen zurück – ein deutlicher Hinweis darauf, dass sowohl der Aufbruch als auch die mögliche Rückkehr sorgfältig durchdacht werden sollten.
Unabhängig vom gewählten Zielland gilt: Eine realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, ausreichende finanzielle Reserven und ein Plan B sind unverzichtbar. Auswandern bedeutet nicht, alle Brücken hinter sich abzubrechen, sondern vielmehr, neue Perspektiven zu erschließen und dabei die Verbindung zur Heimat zu bewahren.